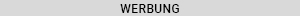Der Fachverband für öffentliche Gesundheit «Public Health Schweiz» ist 100 Jahre alt: Von Beginn an setzte sich der Verband für einen wirksamen «Seuchenschutz» ein – bis zum Kampf für ein Epidemiengesetz 2013 und zur Unterstützung seiner Umsetzung in der aktuellen Covid-19-Krise. Corina Wirth, Geschäftsführerin von Public Health Schweiz, über eine unterfinanzierte Prävention in der Schweiz, Handlungsbedarf beim Errichten von gesundheitsförderlichen Strukturen sowie die Kinder- und Jugendgesundheit, die der Bundesrat in seine Gesundheitsstrategie 2030 aufgenommen hat.

Der Fachverband für öffentliche Gesundheit «Public Health Schweiz» feierte letztes Jahr seinen 100.Geburtstag. Wie haben sich die Schwerpunkte in den letzten Jahrzehnten verschoben?
Corina Wirth: Bei der Gründung von Public Health Schweiz standen Themen wie Hygiene, Säuglingssterblichkeit, Tuberkulose oder Alkoholkonsum im Zentrum. Mit der Verbesserung der medizinischen Leistungen verschob sich der Fokus auf die Behandlung von Krankheiten. Nun gewinnt mit der Zunahme von nicht übertragbaren Krankheiten wie Diabetes oder Herzkreislauferkrankungen die Prävention wieder an Bedeutung, und auch der Einfluss der Umwelt auf die Gesundheit wird stärker thematisiert. Zudem haben sich in den letzten Jahren neue Herausforderungen ergeben wie Antibiotikaresistenzen, Demenzerkrankungen oder der Corona-Pandemie.
Wie gesund sind Herr und Frau Schweizer?
Der Lebenserwartung nach zu beurteilen – sie erfreuen sich guter Gesundheit. Bei der Geburt ist die Lebenserwartung in der Schweiz eine der höchsten der Welt. Allerdings gibt es grosse individuelle Unterschiede. 2,2 Millionen Menschen in der Schweiz leiden beispielsweis an chronischen Krankheiten wie Herzkreislauferkrankungen, Adipositas oder Diabetes. Personen mit tiefem Einkommen und schlechter Bildung sind deutlich häufiger davon betroffen als sozial besser gestellte Personen. Die Einkommenshöhe ist eng verknüpft mit dem subjektiven Gesundheitszustand. Gesundheit ist auch in der Schweiz ungleich verteilt.
Wo liegt bezüglich der öffentlichen Gesundheit – mal abgesehen von Covid-19 – der grösste Handlungsbedarf?
Ich weiss gar nicht, wo anfangen! Es beginnt ja schon beim Namen unseres Verbandes: Es gibt nicht einmal einen deutschen Begriff dafür. Dies widerspiegelt das Stiefmütterchendasein von Public Health in der Schweiz. Es fliessen kaum Gelder in diesen Bereich, und auch die Prävention ist in der Schweiz völlig unterfinanziert. Unser Gesundheitssystem ist zwar sehr leistungsfähig, aber es ist auf die Behandlung von Kranken ausgerichtet. Ich sehe dementsprechend den grössten Handlungsbedarf beim Errichten von gesundheitsförderlichen Strukturen. Denn der Gesundheitszustand der Menschen in der Schweiz wird zu 60 Prozent von Faktoren ausserhalb der Gesundheitspolitik bestimmt. Wenn wir also sichere Velowege einrichten, die Bildung verbessern oder Tabakwerbung einschränken, investieren wir gleichzeitig in die Gesundheit. Eine erfolgreiche Gesundheitspolitik setzt eine systematische, interdisziplinäre Zusammenarbeit voraus. Diese können wir in der Schweiz noch stark verbessern.
Soeben hat die Swiss Public Health Conference 2021 in Bern zum Thema Covid-21 stattgefunden. Was sind die Erkenntnisse der Konferenz?
Die allgemeine Erkenntnis ist, dass Corona weit mehr ist als eine Viruserkrankung. Es wurde deutlich, welch grosse Auswirkungen die Pandemie und die Eindämmungsmassnahmen auf alle Bereiche der Gesellschaft haben. Diese können wiederum die Gesundheit der Bevölkerung beeinflussen. Mein persönliches Fazit war, dass die Pandemie uns als Gesellschaft einen Spiegel vorhält: Probleme, die schon vorher existierten, werden nun für alle sichtbar. Es war beispielsweise unter Expertinnen und Experten schon lange bekannt, dass Personen mit schlechter Bildung und tiefem Einkommen, oft verbunden mit Migrationshintergrund, tendenziell weniger gesund sind und von gesundheitsförderlichen Massnahmen weniger profitieren. Jetzt lesen wir alle in der Presse, dass diese Bevölkerungsgruppen überdurchschnittlich oft mit schweren Covid-Erkrankungen auf den Intensivstationen liegen. Corona hat solche Probleme wie eine Lupe vergrössert und für uns alle unübersehbar gemacht.
Ein Schwerpunkt von Public Health Schweiz ist die Kinder- und Jugendarbeit. Wie steht es generell um die Gesundheit der Kinder in der Schweiz?
In der Schweiz attestieren 98 Prozent der Eltern ihren Kindern einen sehr guten oder einen guten Gesundheitszustand. Die Lebens- und Entwicklungsbedingungen für Kinder sind in der Schweiz im Allgemeinen gut. Aber auch bei den Jüngsten sind die Gesundheitschancen ungleich verteilt: Kinder in armutsbetroffenen oder bildungsfernen Familien sind gesundheitlich benachteiligt. Dies kann sich auf ihr gesamtes Leben auswirken. Frühe Förderung und intersektorielle Zusammenarbeit ist daher sehr wichtig, um die Gesundheit aller Kinder zu fördern.

Public Health Schweiz hat bereits in einem Manifest «Gesunde Kinder und Jugendliche» auf den Mangel an relevanten Daten und den durch Corona nochmals gesteigerte Medienkonsum hingewiesen und Massnahmen gefordert. Wie ist der Stand heute?
Immerhin sind die Anliegen in der Politik angekommen! Mehrere National- und Ständerätinnen und -räte haben die Anliegen des Manifests aufgenommen und Vorstösse dazu eingereicht. Das Anliegen einer umfassenden Strategie und die Forderung nach einer Kinderkohorte waren gerade in der laufenden Herbstsession traktandiert und wurden erfreulicherweise vom Nationalrat klar angenommen. Als Erfolg werten wir auch, dass der Bundesrat die Kinder- und Jugendgesundheit in seine Strategie Gesundheit 2030 aufgenommen hat. Wir erwarten nun vom Bundesrat und auch von den Kantonen klare Massnahmen, damit es nicht bei Lippenbekenntnissen bleibt.
Was braucht ein Kind, damit es gute Chancen hat, sich gesund zu entwickeln?
In erster Linie müssen die Grundbedürfnisse des Kindes befriedigt werden. Dazu gehören Nahrung, Schlaf und Pflege, aber auch Zuwendung, Schutz und Anregung. Ein Kind braucht verlässliche, beständige und liebevolle Beziehungen. Kinder entwickeln sich sehr unterschiedlich, und die Voraussetzungen, in die sie hineingeboren werden, sind keinesfalls immer gleich gut. Wichtig ist, dass allfällige Probleme früh erkannt und angegangen werden. In keinem Lebensabschnitt sind Gesundheitsförderung und Prävention so wirksam, nachhaltig und wirtschaftlich ertragreich wie in der Kindheit und Jugend. Das ist eine der Hauptaussagen des Manifests.
Welche Rolle spielt die Digitalisierung bei der Entwicklung von Kindern?
Ich nehme an, dass Sie Gamen und Bildschirmzeit ansprechen. Die WHO hat die Computerspielsucht 2018 als offiziell anerkanntes Krankheitsbild in ihren Klassifizierungskatalog aufgenommen. Wie sehr einzelne Computerspiele süchtig machen, ist noch nicht hinreichend geklärt, und für Laien ist es schwierig einzuschätzen, wann ein auffälliges Verhalten zur Sucht wird. Es ist bekannt, dass der Medienkonsum von Jugendlichen in der Schweiz während den einschränkenden Corona-Massnahmen massiv gestiegen ist, wobei Jugendliche mit Problemen viel eher geneigt sind, mit Gamen dem Alltag zu entkommen. Problematisch ist, dass Eltern und Betreuungspersonen die Bildschirmzeit der Kinder regulieren und bei auffälligem Verhalten eingreifen müssen. Oft kennen sie diese Welt aber kaum, und sie können auch nicht auf eigenen Erfahrungen zurückgreifen. In der Gesellschaft ist noch wenig Wissen vorhanden. Bei Gamesucht denken beispielsweise viele automatisch an junge Männer. Wer weiss schon, dass junge Frauen von Online-Sucht stärker betroffen sind? Auch soziale Netzwerke können süchtig machen. Glücklicherweise haben Fachstellen und Jugendverbände Informationen und Empfehlungen aufbereitet. In meinen Augen braucht es aber noch mehr Wissen und Aufklärung.
Sie fordern unbürokratisch 125. Mio. Franken Soforthilfe für die psychische Gesundheit von Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Hat Corona die Jungen psychisch so hart getroffen?
Ja. Gemäss der Swiss Corona Stress Study wiesen im März 2021 27 Prozent der befragten Jugendlichen schwere depressive Symptome auf. Die Kinder- und Jugendpsychiatrie ist überlastet. Die Wartefristen betragen beispielsweise im Kanton St. Gallen für reguläre Anmeldungen mehr als fünf Monate. Die Betten in stationären Einrichtungen sind übrigens zum allergrössten Teil von Mädchen belegt. Es wird eine starke Zunahme an Magersüchtigen beobachtet, eine schwer heilbare Krankheit mit potentiell tödlichem Ausgang. Kein Wunder: Die Jugendlichen gingen ja schlichtweg vergessen. Unterricht fand zuhause statt, Lernende blieben über Monate ihrem Lehrbetrieb fern, Treffen mit Freunden waren stark eingeschränkt. Dies, obwohl Jugendliche kaum von Corona-Erkrankungen betroffen waren. Glücklicherweise hat unterdessen in der Gesellschaft und in der Politik ein Umdenken stattgefunden.
125 Mio. Franken klingt vielleicht nach viel – überschlagsmässig sind es aber gerade einmal 125 Franken pro Kind oder Jugendliche/ Jugendlicher. Damit lässt sich etwa eine Stunde bei einer Psychologin oder ein Arztbesuch finanzieren, aber nicht einmal eine Übernachtung in einer Klinik nach einem Selbstmordversuch. Im Vergleich zu anderen Unterstützungsmassnahmen während der Coronakrise sind die 125 Mio. Franken ein Klacks. Leider sind sie trotzdem noch nicht gesprochen worden.
Interview: Corinne Remund
Über Public Health Schweiz
Public Health Schweiz ist die unabhängige, nationale Organisation für öffentliche Gesundheit. Der Verein tritt für die Stärkung und die Weiterentwicklung von Public Health und deren optimale Umsetzung in die Praxis ein und bezweckt das Erreichen und Erhalten eines möglichst guten Gesundheitszustands der Bevölkerung in der Schweiz. Public Health Schweiz fördert mit ihren öffentlichen Veranstaltungen den interprofessionellen und fachübergreifenden Austausch und greift dabei aktuelle Themen der öffentlichen Gesundheit auf.